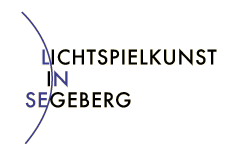
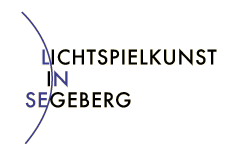

Drama
Regie: Hüseyin Tabak
mit: Laurì (Oskar / Lili) · Florian David Fitz (Ben) · Marie Burchard (Mira) · Burghart Klaußner (Herr Kornmann) · Juan Lo Sasso (Diego Ortiz Costa)
Deutschland 2022 | 122 Minuten | ab 6
Ein Polizist, der nach der Trennung von seiner Frau in Selbstmitleid und Alkohol versinkt, wird damit konfrontiert, dass sein Kind, das er als Sohn kennt, sich als Mädchen fühlt und fortan als solches behandelt werden will. Das feinfühlige Familiendrama fokussiert dabei mehr auf den inneren Konflikt des Vaters und auf die Reaktionen der Umwelt als darauf, was in dem Transkind vor sich geht. Das funktioniert dank der überzeugenden Schauspieler über weite Strecken sehr gut, doch immer dann, wenn es um Grundsatzfragen und Gender Trouble geht, werden die Dialoge recht thesenhaft und weniger überzeugend.
Die Familienverhältnisse sind etwas kompliziert. Der Polizist Ben (Florian David Fitz) liegt in seinem Haus allein in seinem Doppelbett; er lebt getrennt von seiner Frau Mira (Marie Burchard). Es geht in „Oskars Kleid“ auch um ihre beiden Kinder, die noch jung sind und Kita und Grundschule besuchen. Aber vor allem geht es um Ben, der nicht loslassen kann oder will; dabei ist Mira von ihrem neuen Partner Diego (Juan Lo Sasso) schwanger.
Als sie ins Krankenhaus muss, da die Geburt sichtbar naht, und vorerst nicht aufstehen soll, nimmt Ben die Chance wahr, die Kinder zu sich zu nehmen. Er habe schon alles organisiert, das sei kein Problem. Doch dann fährt er mit seinem Kollegen Seyit (Kida Khodr Ramadan) schnell nach Hause, um alle Flaschen einzusammeln, leere und volle; anschließend beantragt er bei seinem Chef kurzfristig Urlaub, den er aber nicht erhält, weil ein Wald geräumt werden muss und Demonstrationen begleitet werden müssen. So sehr es in diesem Film bei der Polizei auch menschelt: ganz so flexibel ist der Dienstplan dann doch nicht.
Trennungsfamilie unter Druck
Anschließend sammelt Ben seine Kinder ein, das ältere beginnt sogleich, die ganzen Alkohol-Verstecke des Vaters abzusuchen und vergewissert sich, dass dort nichts zu finden ist. Wenn Ben zum Einsatz muss, gibt er die Kinder im Kinderparadies eines Möbelhauses ab und holt sie erst viel zu spät wieder ab.
In wenigen Minuten entwirft Regisseur Hüseyin Tabak so präzise und wie brüchig das Porträt einer Trennungsfamilie unter Druck, in der zu viele Themen nicht geklärt sind und in der vor allem der Vater sich nicht anzupassen vermag.
Florian David Fitz und Marie Burchard spielen dieses Paar, an dessen Interaktionen man kontinuierlich die Vertrautheit wie die Verletzungen spürt; Juan Lo Sasso
steht als Diego gekonnt wohlwollend und zugleich hilflos zwischen den beiden. In all den Verwerfungen, die der Film nach wenigen Minuten beginnen lässt, sind es stets die Darsteller.innen, auf deren Schultern alles ruht; und Laurì und Ava Petsch als die Kinder von Ben und Mira sind ein Lichtblick, weil sie ernsthaft sind, miteinander verschworen und einander zugewandt auftreten.
Der erste Morgen beim Papa aber fördert den Konflikt zu Tage, den der Film schon in seinem (problematischen) Titel trägt. Denn das Kind, das Ben bisher „Oskar“ nennt und auch noch lange so nennen wird, steht oben an der Treppe im Kleid und erklärt seinem Vater: „Ich heiße Lili.“
In Lilis Koffer sind rosa Mädchensachen, ihr Lieblingskleid ist aber gelb. Irgendwie haben Mira, Diego, Lili und ihre Schwester Erna von der Entwicklung der vergangenen Monate – dass Lili an ihrer neuen Schule als Mädchen eingeschult wurde, dass sie am liebsten dieses Kleid trägt und dass sie mit einem neuen Namen angesprochen werden will – dem Vater bislang nicht gesagt. Weil sie, so will es das von Hauptdarsteller Florian David Fitz verfasste Drehbuch, Angst vor seiner Reaktion hatten. Und genau seine Reaktion gibt ihnen jetzt natürlich recht.
Auf der Klaviatur des „Gender Trouble“
Schon der Umgang mit einem trans Kind wäre Stoff genug für einen Film. Wie sollen die Eltern darauf reagieren? Wie es anderen erklären? Und welche Verwirrung löst das bei ihnen selbst aus? Das wären gewichtige Themen. Doch das Drehbuch wirft diese zentrale Frage mitten in einen Wirbelsturm von nicht gelösten Konflikten: Bens Alkoholismus, der eher unter ferner liefen und als reine Stressreaktion abgehandelt wird; Bens jüdische Eltern (Senta Berger, Burghart Klaußner), die immer noch nicht damit klarkommen, dass ihr Sohn die Uniform des deutschen Staates trägt, und die auch sonst mit seinem Leben nicht zufrieden sind. Sie sind progressiv und vegetarisch („In unserem Haus gibt es keine Wurst“), aber mit Lili haben sie dann doch ihre Probleme.
Tabak und Fitz haben sich viel vorgenommen und spielen auf der Klaviatur des „Gender Trouble“ alle „War nicht böse gemeint“-Bemerkungen und Vorurteile durch. „Siehst aus wie ein Hippie“, bekommt Lili angesichts ihrer langen Haare von Bens Kollegen zu hören, die sie allesamt noch als Junge behandeln. Ben zieht seine ersten Informationen über Transgender aus fragwürdigen Youtube-Videos, in denen „trans als Trend“ bezeichnet wird; schon Kindern, so geht die Mär (auch draußen in der realen Welt der transfeindlichen Agitateur:innen) würde eingeredet, sie seien trans.
In diesem Punkt muss Ben dazulernen: Die einzige Person, die Lili wirklich in eine bestimmte Richtung drängen will, ist er selbst. Als ihm ein Psychologe so paradox wie vorsichtig sagt: „Ich glaube, dass es möglich ist, dass ihr Sohn ein Mädchen ist“, stürmt Ben empört aus der Praxis. Generell sind hier fast durchweg die Männer die Verhärteten, die sich nicht oder nur mühsam aus vorgefertigten Positionen, Haltungen und Meinungen lösen können, selbst wenn sie mit freundlichem, aber bestimmtem Nachdruck („Ich heiß’ Lili. Ich möchte meine Sachen haben.“) von ihren eigenen Kindern und Enkelkindern geschubst werden.
Das ist in der Tat auch der zentrale Fokus von „Oskars Kleid“. Der Film dreht sich weniger um die Identität des Kindes oder darum, was die Reaktionen der Umwelt für Lili bedeuten, sondern es geht primär um Bens Umgang mit dieser Veränderung. Er sucht Rat bei einem Rabbi und bei einer trans Frau, die er im Polizeipräsidium trifft.
Wie lang sind die Haare?
Diese Perspektive ist völlig legitim; aber sie führt dazu, dass „Oskars Kleid“ die Identität von Lili häufig über Oberflächenphänomene beschreibt und thematisiert – und nicht primär über ihre eigene Welterfahrung. Dazu trägt schon der Filmtitel bei, der sie mit dem Namen anspricht, den sie selbst ablehnt; in der realen Welt wird dies als „deadnaming“ bezeichnet, eine Praxis, die trans Personen ihre Identität abspricht.
Zudem wird Lilis Geschlechtsidentität im Titel wie im Film hauptsächlich an Äußerlichkeiten verhandelt: Stehen oder sitzen beim Klo-Gang, Kleid oder Hose, wie lang sind die Haare? So werden gängige, aber für Lili womöglich nicht gültige Dichotomien immer weiter bedient. Das ist letztlich sehr reduktiv und entspricht zwar der äußerlichen Sicht auf Identität, wie sie gesellschaftlich de facto passiert – Lilis Perspektive wird allerdings
deutlich weniger facettenreich beschrieben.
Genau hier liegt das zentrale Problem von „Oskars Kleid“. So feinfühlig Tabak die Schauspieler:innen auch leitet, so emotional authentisch sie in nahezu allen Situationen wirken, sobald das Gespräch den Kern der Frage berührt, wer und wie Lili ist und was ihre Identität für die Familie bedeutet, rutschen die Dialoge, die Sätze schnell ins Thesenhafte ab, wirken sie wie auswendig gelernt. Das ist gut gemeint und auch nicht völlig falsch und läuft am Ende auch auf ein Happy End hinaus. Aber es ist emotional nicht präzise. So selbstbewusst das neunjährige Kind auch auftritt (und das tut es sehr), so sehr bleibt der Kern von dem, was Lili bewegt, immer holzschnittartig. Das aber reduziert sie zur Nebenfigur von Bens Entwicklung; ihre trans Identität ist die Herausforderung, an der der Vater wächst.
Auf dünnem Eis
Ob Lili als Figur eine realistische Darstellung dessen ist, wie Kinder mit ihrer Geschlechtsidentität umgehen, lässt sich schlecht einzuschätzen; die junge Darstellerin Laurì jedenfalls ist sehr überzeugend.
All dies sind keine nebensächlichen Fragen, sondern von großer Wichtigkeit, weil der Film von Hüseyin Tabak in ein politisches Wespennest sticht, was bei diesem Regisseur seit seinem Debütfilm „Deine Schönheit ist nichts wert“ keine Überraschung ist. Im Film klingt es nur leise an, aber außerhalb der Kinos werden trans Personen von einer unheiligen Allianz von Rechtskonservativen und Rechtsextremen oft pauschal herabgewürdigt. Die Diskussion um das Selbstbestimmungsgesetz wird sehr heftig und emotional geführt. Und zugleich melden sich die Betroffenen, ihre Freund:innen und Familien mit berechtigt großem Selbstbewusstsein zu Wort.
„Oskars Kleid“ wird deshalb von allen Seiten kritisch begleitet werden. Es muss sich erst zeigen, ob der Film und seine Macher:innen dem gewachsen sind.
Rochus Wolff, FILMDIENST