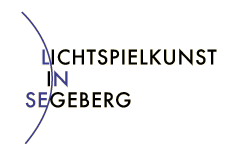
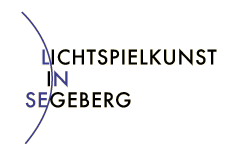

Tragikomödie
Regie: Asaph Polonsky
mit: Shai Avivi (Eyal Spivak), Evgenia Dodina (Vicky Spivak), Tomer Kapon (Zooler), Alona Shauloff (Bar), Uri Gavriel (Refael), Sharon Alexander (Shmulik Zooler), Carmit Mesilati-Kaplan (Keren Zooler)
Israel, 2016, ab 6, 98 min.
Ein israelisches Ehepaar hat seinen 25-jährigen Sohn zu Grabe tragen müssen und beschreitet nach der siebentägigen Trauerzeit unterschiedliche Wege, um mit dem Verlust umzugehen. Während sich die Frau in ihre Arbeit als Grundschullehrerin flüchtet, weiß der Mann nicht, wohin mit sich und seinen Gefühlen und macht sich gemeinsam mit einem Nachbarjungen über die Cannabis-Medizin des Toten her. Tragikomödie mit komisch-absurden Seiten, die zwischen irrem Lachen und depressiver Lethargie um Bewältigung ringt.
Wahrscheinlich trauert jeder anders. Auf die israelischen Eheleute Eyal und Vicky, die vor einer Woche ihren 25-jährigen Sohn nach langer schwerer Krankheit zu Grabe getragen haben, trifft das in jedem Fall zu. Selbst wenn der Verlust und der Schmerz, den sie erleben, derselbe ist. Vicky möchte nach Ende der Shiva, der siebentägigen jüdischen Trauerzeremonie, so schnell wie möglich zur Tagesordnung zurückkehren. Lieber heute als morgen will die Lehrerin wieder unterrichten. Sogar einen Zahnarzttermin nimmt sie wahr und beißt, als ihr ein Abdruck genommen wird, symbolträchtig die Zähne zusammen. Dabei kullert ihr eine Träne über die Wange.
Eyal dagegen kommt nicht vom Fleck. Die Nachbarn, die einen Salat vorbeibringen, jagt er fluchend aus dem Haus. Der Salat landet mitsamt der Schüssel im Müll, aus dem Vicky ihn wieder herauskramt. Die Glasschüssel liefert sie später nebenan ab und gibt vor, dass der Salat „lecker“ geschmeckt habe. Ständig versucht sie, den anderen etwas vorzumachen, ihre Trauer zu verbergen. Eyal dagegen streitet sich mit einem Taxifahrer, verpasst der Nachbarin eine Ohrfeige und prügelt sich anschließend mit deren Mann. Zwei gegensätzliche Verarbeitungsstrategien, für die Regisseur Asaph Polonsky in seinem Spielfilmdebüt ebenfalls ein Symbol parat hält: Während Eyal ständig die elektrischen Rollläden herunterlässt, fährt Vicky sie wieder hoch.
So weit, so vertrackt. Doch dann lässt Eyal im Krankenhaus das Cannabis seines verstorbenen Sohnes mitgehen. Da er nicht im Stande ist, sich einen Joint daraus zu drehen, kommt Zooler ins Spiel, der Sohn der Nachbarn. Der wohnt mit Ende 20 noch immer zu Hause, jobbt bei einem Sushi-Service und scheint nie wirklich erwachsen geworden zu sein. Aber einen Joint kann er bauen. Damit hält eine komisch-absurde Seite Einzug in die Tragikomödie. Die beiden ungleichen Männer verkiffen fortan den Tag zusammen. Zooler liefert im Wohnzimmer eine bizarre Luftgitarrenperformance ab; zusammen führen sie an der krebskranken Mutter eines kleinen Mädchens, das Eyal in der Klinik kennengelernt hat, eine pantomimische Operation durch.
Da aber jeder ein wenig anders trauert, dürfte diese Art von Humor nicht nur auf Wohlgefallen stoßen. Am leichtesten tun sich mit dem Film wohl jene, die noch nie einen geliebten Menschen verloren haben. Allerdings dürfte ihnen „Ein Tag wie kein anderer“ auch am wenigsten sagen, auch weil sich die Inszenierung zwischendurch recht schwerfällig in die Länge zieht. Wer mit der Situation der Trauernden aber vertraut ist, für den wird es unter Umständen komplizierter. Denn das befreiende Lachen hält nicht lange an. Auch Eyal fällt regelmäßig in depressive Lethargie zurück. Der bekannte israelische Kabarettist Shai Avivi spielt das glänzend, fein nuanciert, ohne zu überziehen. Überhaupt ist der Film schauspielerisch herausragend. Evgenia Dodina besticht als Vicky, hinter deren fragiler Fassade eine abgrundtiefe Trauer durchschimmert. Und Tomer Kapon ist in der Rolle des chaotischen Kindskopfs Zooler schlichtweg ein Ereignis.
Regisseur Polonsky erweist sich in diesem tragikomischen Kabinett unterschiedlicher, mal konventioneller, mal grotesker Trauerweisen als sorgsamer Beobachter. Genau darin aber liegt eine Schwäche des formal faszinierenden und poetisch fotografierten Filmes. Die Verstorbenen treten nicht in Erscheinung. Nur im Spiegel der Trauer werden sie sichtbar. Das klug durchdachte Spiel mit dem Unsichtbaren, das sich als thematischer Leitfaden (Luftgitarre, Pantomime) durch den gesamten Film zieht und Erinnerungen an das legendäre Tennisspiel aus Antonionis „Blow Up“ (fd 14 724) weckt, verleiht dem Film zugleich etwas künstlich Distanziertes, Unpersönliches.
Was fehlt, spürt man in jener Szene, in der Eyal und Zooler auf dem Friedhof der Trauerrede des Bruders der Verstorbenen lauschen, die das Grab neben Eyals Sohn erhalten hat. Wenn der Redner sich an seine sterbende Schwester Meirav erinnert, erwacht sie im Geiste zu Leben. Die vage durch den Film wabernde Trauer wird für einen Augenblick konkret – und fast unerträglich. Am liebsten würde man sie mit den Hinterbliebenen hinausschreien.
Dorthin, wo es derart wehtut, wagt sich „Ein Tag wie kein anderer“ sonst nicht. So bleibt am Ende nicht nur die Tragik, sondern auch die Komik, die daraus erwächst, seltsam gedämpft und kulissenhaft.
Stefan Volk, FILMDIENST 2017/10