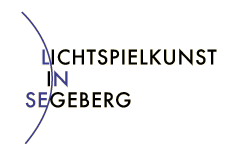
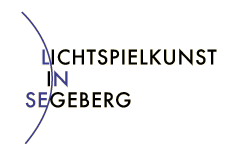

Drama Literaturverfilmung
Regie: Matti Geschonneck
mit: Bruno Ganz (Wilhelm Powileit), Hildegard Schmahl (Charlotte Powileit), Sylvester Groth (Kurt Umnitzer), Evgenia Dodina (Irina Umnitzer), Natalia Belitski (Melitta), Alexander Fehling (Sascha Umnitzer), Gabriela Maria Schmeide (Lisbeth), Alexander Hörbe (Mählich), Thorsten Merten (Tabbert), Angela Winkler (Stine Spier), Stephan Grossmann (Harry Zenk), Pit Bukowski (Arbeiter), Inka Friedrich (Vera)
Deutschland 2017, 101 min.
Im Herbst 1989 richtet die Ehefrau eines verdienten SED-Parteigenossen eine Geburtstagfeier für den 90-jährigen Jubilar aus. Während des Festtags, der nach den immer gleichen Ritualen einer versteinerten Gesellschaft abläuft, soll tunlichst nicht über Perestroika oder die Massenflucht aus der DDR gesprochen werden, gleichwohl drängen konfliktreiche (Familien-)Geheimnisse ans Tageslicht. Die Verfilmung des Romans von Eugen Ruge kreist um die glänzend gespielte Figur des sozialistischen Granden und taucht das Geschehen inszenatorisch in ein betont altmodisch-vergilbtes Licht.
Es ist der Morgen des 90. Geburtstags von Wilhelm Powileit, einem realsozialistischen Patriarchen. Letzte Vorbereitungen für die Feier werden getroffen. Der verdiente SED-Parteigenosse putzt sich zum Empfang seiner Gäste heraus. Er nimmt ein Bad, bräunt das Gesicht unter einer altertümlichen Höhensonne, holt seinen schmucken Anzug vom Bügel und begibt sich zu seinem Frühstück, einer Portion Haferflocken. Der schon etwas senile Alte soll heute für seine Verdienste einen Orden in Gold empfangen. Damit das Fest seinen gewohnten Gang nimmt, unterbindet Ehefrau Charlotte alle tagespolitischen Gespräche über Perestroika oder die Massenflucht der DDR-Bürger. Auf dem Höhepunkt der Feier aber platzt die Bombe: Powileits Sohn Kurt gesteht, dass der Enkel Sascha in die Bundesrepublik geflüchtet ist.
Regisseur Matti Geschonneck und sein Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase haben die Adaption von Eugen Ruges preisgekröntem Roman weitgehend auf den Ablauf des Festtages konzentriert. Sie schicken den Feierlichkeiten nur eine kurze Szene voraus, ein Gespräch zwischen Kurt und seinem Sohn, das Saschas Flucht erklären soll und zugleich die Entfremdung zwischen beiden sichtbar macht. Der Film will dadurch die Spannungen in der Familie verdichten, sie schrittweise auf den zentralen Konflikt zuspitzen.
Vor den Augen des Zuschauers gesellt sich eine unwirklich anmutende „Saurierversammlung“ ein, wie es dem Urenkel im Roman einmal durch den Kopf schießt. Der Festtag wird mit den immergleichen Ritualen begangen, was durchaus an die Paraden der SED-Parteispitze erinnern soll. Der Pionierchor gratuliert mit einem Lied; die Einheit von Partei und werktätigem Volk wird herausgestrichen, indem sich der Abschnittsbevollmächtigte, die Vertreter des Kombinats und die der Partei um Wilhelm Powileit scharen und die Dienste des Genossen würdigen.
Doch wie in der Realität des Jahres 1989 bricht plötzlich die Versteinerung auf. Mit der Nachricht von der Flucht des Enkels kommt etwas auf den Tisch, was bislang nie ausgesprochen wurde: dass die Einheit der Familie nämlich nur durch die Verleugnung ihrer ideologischen Spaltung zu haben war. Als Sinnbild wählt die Inszenierung dafür den entzwei brechenden Esstisch, ein Erbstück aus NS-Zeiten, mit dem das appetitliche Büffet zu Boden geht. Wilhelm indes thront ungerührt in seinem Plüschsessel, wirft knurrig mit Floskeln um sich, von denen er glaubt, dass sie witzig und treffsicher seien. Seine Gestalt, gespielt von Bruno Ganz, persifliert die sozialistische Gerontokratie, die jede Kritik mit den abgedroschenen ideologischen Schlagwörtern parierte und dadurch die Misere zusätzlich verschärfte.
Formal wird das erstarrte, heute so lächerlich wirkende Gehabe dadurch unterstrichen, dass die Kamera die Figuren in dem niedrigen, mit dunklem Holz getäfelten Raum immer wieder zusammendrängt. Die Anwesenden wirken wie in eine kleinbürgerliche Puppenstube verpflanzt; sie werden zu Gruppen arrangiert, die an Kompositionen der realistischen Genremalerei des 19. Jahrhunderts erinnern. Schräge Perspektiven und eine dramatische Lichtführung verfremden überdies und streichen den vergilbten Charakter der Feier heraus.
Obwohl auch der Roman dem Festtag ebenfalls ein besonderes Gewicht einräumt, erweist sich das Konzept des Films als unzulänglich. Es vermag nämlich nicht anschaulich zu machen, weshalb sich Menschen für dieses System engagiert haben und 40 Jahre lang einbinden ließen. Im Roman erzählen die Figuren aus persönlicher Perspektive von den unterschiedlichen Epochen in ihrem Leben, womit der Leser einen Einblick in einen Zeitraum erhält, der sich von der Aufbauzeit der DDR über die Wende bis ins Jahr 2001 erstreckt. Das Fest dient dort dazu, die Unterschiede im individuellen Erleben aufzuzeigen: einzelne Wahrnehmung und Verhaltensweisen, wie sie sich durch die Historie ausgebildet haben. Die ideologischen Gräben zwischen der zweiten und der dritten Generation wurden dabei schon Ende der 1970er-Jahre aufgerissen und nicht erst im Jahr 1989. Der Roman führt anhand seiner Figuren vor, wie ein Denken funktioniert, das sich in die Parteidisziplin fügt, obwohl es darum weiß, dass „der Kommunismus Blut frisst“, wie Charlotte Powileit das formuliert, und Menschen im parteilichen Richtungsstreit verheizt werden; oder Karrierebestrebungen von Frauen hinter denen der Männer zurückstehen müssen. Ruge bezieht dabei elegant die in der DDR stets schwelenden Konflikte zwischen Alt und Jung mit ein, zwischen Männern und Frauen, Westemigranten und jenen Kadern, die aus Russland zurückkamen, zwischen den liberalen und stalinistischen Strömungen in der Partei.
Indem der Film aber seine Geschichte wie eine Mär aus vergangener Zeit mit Impressionen aus der russischen Stadt Slawa rahmt, der Heimat von Kurts Frau und deren Mutter und für ihn zugleich der Ort seiner Verbannung, umspielt mit russischen Akkordeonweisen, wird die Aussage des Buches verdreht. Der Roman beginnt und endet mit der Reise des krebskranken Enkels Sascha im Jahr 2001 nach Mexiko, auf den Spuren seiner Großmutter Charlotte, womit er sich auf die Suche nach den (ausgegrenzten) Stimmen der Westemigranten und dem tragischen Schicksal der vor dem Sozialismus geflohenen Söhne begibt. Hiervon erzählt der Film nichts.
Heidi Strobel, FILMDIENST 2017/11