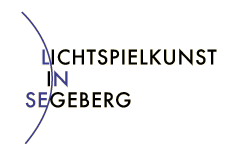
Programm per Email
Werden Sie Mitglied
Werden Sie Mitglied!
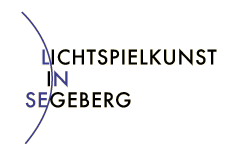

Drama
Regie: Christian Schwochow
mit: Levi Eisenblätter (Siggi Jepsen, Kind) · Tobias Moretti (Max Ludwig Nansen) · Ulrich Noethen (Jens Ole Jepsen) · Maria Dragus (Hilke Jepsen) · Johanna Wokalek (Ditte Nansen)
Deutschland 2019 | 125 Minuten | ab 12
Nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert sich ein junger Mann in einer Besserungsanstalt an den Konflikt, der ihn an den Rand des Wahnsinns gebracht hat. Während der NS-Zeit hatte sein Vater als Dorfpolizist einen Maler verfolgt und sich zum brutalen Mittäter gemacht. Doch auch nach dem Untergang des Regimes ändert er seine Haltung nicht. Von ausgezeichneten Darstellern getragene Verfilmung des 1968 veröffentlichten Romans von Siegfried Lenz.
Das erste Bild des Films, das Motiv von Gitterstäben einer Gefängnistür, signalisiert Enge, Bedrängnis, Bedrohung. Der Regisseur Christian Schwochow schlägt bereits hier eines der Themen an: die erzwungene Gefangenschaft, das Eingesperrtsein in gesellschaftliche wie private Zwänge. Siggi Jepsen, die Hauptfigur, ist nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in einer Besserungsanstalt für Jugendliche gelandet. In den Schulstunden wird den jungen Häftlingen ein Aufsatz abverlangt: „Die Freuden der Pflicht“. Siggi gibt zunächst ein leeres Blatt ab, um später, in der Einzelzelle, nicht mehr mit dem Schreiben aufzuhören.
Die Freuden der Pflicht: Diese Aufgabe wird ihm Anlass für eine detaillierte Selbstreflexion, für ein Nachdenken über die eigene Biografie. Vor dem Wohin kommt das Woher: Wie wurde ich, was ich bin? Wer drückte mir den Stempel auf, der meine Haltungen und Handlungen prägt? Wie entstand das zerstörerische Potenzial der eigenen Seele? Das Schreiben als obsessiver Akt. Selbst als die vorgesehene Zeit in der Einzelzelle vorüber ist, verlangt Siggi nach mehr Papier und mehr Geduld: Das Resümee des Lebens muss zu Ende gedacht und gebracht werden.
Die Figur des Vaters als Negativfolie
Diese Selbstvergewisserung hinter Gittern ist Ausgangspunkt für eine Reise in die Vergangenheit. Der Film „Deutschstunde“ nach dem gleichnamigen, 1968 erschienenen Roman von Siegfried Lenz hebt in Rückblenden das letzte Jahrzehnt ins Blickfeld. Die Figur des Vaters dient dabei als Negativfolie für Siggis eigene Emanzipation, Der alte Jepsen war und ist Dorfpolizist, von der Weimarer Republik bis zu Hitlers Terrorregime, ein deutscher Beamter, der die Befehle des Staates ohne Wenn und Aber durchsetzt. Ulrich Noethen spielt ihn als einen Mann, der ganz in seinen Hierarchien aufgeht; Pflichterfüllung ist oberstes Gebot, und sei es auch gegen den eigenen Verstand, vielleicht auch gegen die eigene ursprüngliche moralische Disposition, die längst verschüttet ist.
Allerdings geht das Drehbuch mit Jepsen etwas eindimensional um: Der Figur hätte der eine oder andere Selbstzweifel gut getan, da wären mehr Schichten freizulegen gewesen.
Eine Art Gegenentwurf zu Jepsen ist der expressionistische Maler Max Nansen (Tobias Moretti), zu dem sich Siggi deutlich mehr hingezogen fühlt als zu seinem strengen Vater. Ursprünglich ein enger Freund von Jepsen, sieht sich der Künstler nun der Verfolgung durch den NS-Staat ausgeliefert. Seine Bilder sind nicht opportun, zu abstrakt, zu wenig aufbauend; er erhält Malverbot, das er aber nicht einhalten kann und will: Nicht mehr an der Staffelei zu stehen, wäre für ihn ein schleichender Tod.
Zwischen seinem Elternhaus und dem Haus des kinderlosen Malers und dessen Frau (Johanna Wokalek) eröffnen sich für den Jungen Siggi ethische Welten. Wenn der Vater dem anderen das Malen verbietet, die Bilder sogar konfisziert oder abholen lässt: Ist das Recht? Oder doch nur eine Willkür, die nicht nur die Seele des Malers tief verletzt, sondern auch die des Heranwachsenden?
Auf welcher Seite will ich stehen?
Und dann die Geschichte des älteren Bruders, der sich im fernen, nahen Krieg selbst verstümmelt hat und vom Vater verraten wird, dem sicheren Tod ausgeliefert. Solche Erlebnisse, die eng mit dem Alltagsterror im NS-Staat verbunden sind, verlangen Siggi Entscheidungen ab, die ein Kind kaum zu bewältigen vermag: Auf welcher Seite will ich stehen? Was kann ich tun, um dem Verfemten zu helfen?
Als der Frieden da ist, die neue Zeit beginnt, kommt das noch größere Erwachen: Der Vater ändert sich nicht, er sieht nichts von seinem Unrecht ein; auch die brutalen Ausbrüche setzen sich ungebremst fort. Was ist die neue Gesellschaft wert, wenn er sogar seinen Posten wiederbekommt, der ewige Dorfpolizist, als ob er im Getriebe der Angst und des Hasses, im Räderwerk des „Dritten Reiches“, nicht schrecklich funktioniert hätte?
Angestrengter Kunstwille
Für seine Geschichte fand Siegfried Lenz eine millionenfache Leserschaft, in beiden deutschen Staaten und weit darüber hinaus. Peter Beauvais hat 1971 einen fast vierstündigen Fernseh-Zweiteiler daraus gemacht, damals ein großer Erfolg. Daran anzuknüpfen, dürfte dem neuen Film schwerfallen, und das liegt kaum an den durchaus eindrucksvoll agierenden Schauspielern, vor allem auch den Kinderdarstellern, die Schwochow mit großer Einfühlung führt.
Der Film leidet vielmehr unter seinem angestrengten Kunstwillen, der ins Kunstgewerbliche abdriftet. Als ob die Naturmotive an der Nordsee nicht ausgereicht hätten, mit deren Hilfe Schwochow und sein Kameramann Frank Lamm eine Seelenlandschaft zwischen Labyrinth und Freiheit entwerfen, müssen immer wieder symbolisch aufgeladene Bilder die Handlung anheizen. Das beginnt mit brennenden Staffeleien im wogenden Meer und hört mit malerisch drapierten Tierkadavern noch lange nicht auf. Siggis innere Konflikte, sein zunehmender Wahn in morbider Umgebung werden so nach außen gekehrt. Doch es ist ein altmodischer Symbolismus, der hier die Szene bestimmt.
Das Szenenbild atmet kein Leben
Hinzu kommt, dass die Interieurs so aussehen, als hätte der Set-Designer sie frisch hingebaut. Das Szenenbild atmet kein Leben, es gibt kein Stäubchen, keine Unruhe, sondern nur exakt gestylte metaphorisch grundierte Langeweile. Auch die Dramaturgie nimmt sich seltsam archaisch aus: In der Gegenwartshandlung, im Gefängnis, wird dem Häftling Wasser gebracht, Schnitt, die Rückblende beginnt mit Regen. Wasser folgt auf Wasser. Wie einfältig!
Eine solche nach Bedeutsamkeit lechzende Erzählweise macht den Film auf schwerfällige Weise „klassisch“. Modernes Kino, und sei es auch nach einem alten Roman, sieht anders aus.
Ralf Schenk, FILMDIENST