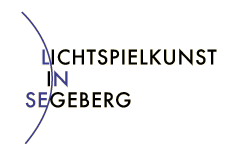
Programm per Email
Werden Sie Mitglied
Werden Sie Mitglied!
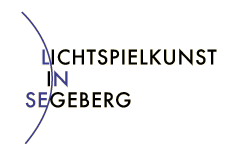

Drama
Regie: Cécilia Rouaud
mit: Vanessa Paradis (Gabrielle) · Camille Cottin (Elsa) · Pierre Deladonchamps (Mao) · Jean-Pierre Bacri (Pierre) · Chantal Lauby (Claudine)
Frankreich 2018 | 99 Minuten | ab 0
Drei einander entfremdete Geschwister versuchen, sich abwechselnd um ihre demente Großmutter zu kümmern. Doch ihre jeweiligen Lebensumstände lassen sie bald erkennen, dass sie sich mit der gut gemeinten Absicht übernommen haben. Eine mit neurotischen Charakteren, Situationskomik und spitzzüngigen Dialogen operierende Tragikomödie, deren Witz durch das schematische Drehbuch eher verhalten ausfällt. Anrührend und lebensnah ist der ernste Nebenstrang um die schwächer werdende Großmutter und die Ohnmacht ihrer Angehörigen. - Ab 14.
Tragikomödie um drei Geschwister, sich abwechselnd um ihre demente Großmutter kümmern wollen, aber bald erkennen, dass sie sich damit übernehmen.
Bewegungslos auf einem Fleck stehen, in der Sonne strahlen und Touristen ein prächtiges Fotomotiv bieten: Wenn Gabrielle sich an einem schattigen Platz nahe der Seine als lebende Statue aufstellt, darf man die rund 40-jährige Frau in ihrem Idealzustand wähnen. Unpraktisch ist der goldene Überzug allerdings dann, wenn Gabrielle ihn schnell wieder loswerden muss, weil sie an diesem Tag Wichtigeres zu tun hat als im öffentlichen Raum zu performen.
Ermahnt von ihrem leicht genervten 12-jährigen Sohn, eilt Gabrielle zur Beerdigung ihres Großvaters, trifft trotz aller Mühe aber erst während der kirchlichen Trauerfeier ein. Damit ist sie nicht einmal die Letzte. Dieser Part fällt ihrem Bruder Mao zu, der sich erst auf dem Friedhof unter die Trauernden reiht, allerdings nicht aus Schusseligkeit wie Gabrielle, sondern weil er sich nicht zum Aufbruch entschließen konnte.
Echte Trauer um den Toten, einen offensichtlich wenig sympathischen Zeitgenossen, verspüren weder Gabrielle noch Mao, was aber auch für die pünktlich erschienenen Gäste gilt: ihre pflichtbewusste Schwester Elsa, die seit langem geschiedenen Eltern der drei Geschwister sowie die Großmutter, deren Demenz sie schon während der Beerdigung vergessen lässt, wer dort eigentlich begraben wird.
Erinnerungen an den Sommer auf dem Land
Das seltene Zusammentreffen der Familie anlässlich der Trauerfeier dient der französischen Regisseurin Cécilia Rouaud dazu, die Themen des Films auszubreiten. Die drei Geschwister sind alle mehr schlecht als recht im Leben vertäut; ihre unerfreuliche Kindheit hat tiefe Narben hinterlassen. Ihre von Post-68er-Liberalität geprägten Eltern setzten auf Erziehungsmethoden, die von der Freiheit der Kinder sprachen, in der Umsetzung aber eher Vernachlässigung bedeuteten. Zudem wurden die drei durch die elterliche Scheidung getrennt; danach verbrachten sie nur noch in den Sommerferien eine gemeinsame Zeit im Dorf der Großeltern.
Diese Urlaube gelten den Geschwistern als glücklichste Abschnitte ihres Lebens; alte Fotos von inniger Dreisamkeit verstärken diesen Eindruck, wobei manche Aspekte, etwa der unleidliche Opa, ausgeblendet werden. Die verklärten Erinnerungen bestärken insbesondere die Schwestern in ihrem Entschluss, die hilfsbedürftige Großmutter nicht in ein Altersheim abzuschieben, sondern künftig im Wechsel bei ihnen wohnen zu lassen.
Die Oma soll nichts in Altenheim
Die Inszenierung nutzt die Sorge um die Großmutter zunächst, um die drei Geschwister in ihren gescheiterten Lebensentwürfen vorzustellen. Der alleinerziehenden Gabrielle fehlt die Bereitschaft, sich auf profane Dinge wie einen festen Job oder eine dauerhafte Beziehung einzulassen; ihr Sohn drängt deshalb darauf, lieber bei seinem Vater zu wohnen. Mao ist als Computerspiele-Entwickler zwar kreativ und finanziell versorgt, stößt mit depressiven Schüben aber ebenfalls seine Umgebung von sich weg und hadert bei einer Psychologin mit seiner traumatischen Kindheit. Elsa erscheint als die Stabilste der drei, leidet aber an ihrem unerfüllten Kinderwunsch. Schnell zeigt sich, dass sich keiner von ihnen um eine alte Frau kümmern kann, die lieb und unaufdringlich ist, aber ständig davonläuft und eine Betreuung rund um die Uhr bräuchte. Nach einer Reihe von aufreibenden Episoden bleibt doch nur das Altersheim.
„Das Familienfoto“ ist bei allen ernsten Elementen eindeutig als Komödie konzipiert. Nach bewährten Screwball- und Sitcom-Mustern hat Rouaud auch die Nebenfiguren mit potenziell witzigen Eigenschaften und Widersprüchen ausgestattet; es gibt Missverständnisse, peinliche Situationen und sarkastische Kommentare; der unsensible Umgang der altlinken Eltern mit ihren psychisch angeknacksten Kindern hätte das Potenzial zum Running Gag.
Allerdings fehlt es dem Film an herausragenden komischen Momenten; er lädt eher zum Schmunzeln ein, während sich öfters auch Leerlauf einschleicht. Das liegt vor allem an der durchgängigen psychologischen Schematik der Protagonisten: bei Gabrielle bildet der Traumjob als lebende Statue den Kontrast zur chaotischen Lebensart; der Entwickler Mao bekommt im wahren Leben nichts auf die Reihe, Elsa hilft straffällig gewordenen jungen Menschen bei der Reintegration, neigt aber selbst zu aggressiven Ausfällen. Der vordergründigen Charakterzeichnung entsprechen kaum einmal wirklich sprühende Dialoge, was in dem bis auf einige nette Paris-Aufnahmen visuell wenig aufregenden Film umso mehr auffällt.
Absage an Feelgood-Klischees
Teilweise gerettet wird „Das Familienfoto“ nur durch den Nebenstrang um die schwächer werdende Großmutter. In einer bemerkenswerten Absage des Films an Feelgood-Bedürfnisse müssen die drei Geschwister erkennen, dass sie an ihrer Großmutter nicht die Fehler ihrer Eltern ausbügeln können; der Vater der drei kann seine lange Abwesenheit ebenfalls nicht einfach ungeschehen machen.
Für den Wunsch, einem geliebten Menschen etwas Gutes tun zu wollen, und die ohnmächtige Einsicht, dass es dafür zu spät ist, findet Rouaud eindringliche Bilder und Szenen. Frei von dem forcierten Charakter des Humors sind dies nicht nur effektvolle Schnappschüsse, sondern tatsächlich „wie aus dem Leben gegriffene“ Momentaufnahmen.
Marius Nobach, FILMDIENST