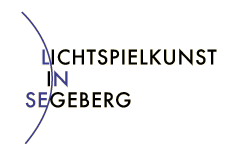
Programm per Email
Werden Sie Mitglied
Werden Sie Mitglied!
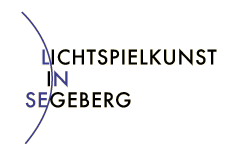

Biopic
Regie: Adam McKay
mit: Christian Bale (Dick Cheney) · Amy Adams (Lynne Cheney) · Steve Carell (Donald Rumsfeld) · Sam Rockwell (George W. Bush) · Alison Pill (Mary Cheney)
USA 2018 | 134 Minuten | ab 12
Kritisches Filmporträt des US-Politikers Richard „Dick“ Cheney, der von den 1960er-Jahren an in republikanischen Regierungen die Politik der USA mitprägte und vor allem als Vizepräsident (2001-2009) zahlreiche fatale Entscheidungen verantwortete. Der differenzierte Film folgt Cheneys Lebens- und Berufsstationen weitgehend chronologisch, stellt sie aber durch Kommentare, Bildmontagen und surreale Illusionsbrüche in einen größeren Zusammenhang. Dadurch weitet sich das formal und darstellerisch brillante Werk zur bitteren Satire auf ein über Jahrzehnte aufgebautes System, in der neben skrupellosen Machtmenschen auch geistig träge Wähler aufs Korn genommen werden. - Sehenswert
Kritisches Porträt des US-Politikers Richard „Dick“ Cheney, der von den 1960er-Jahren an in republikanischen Regierungen die Politik der USA mitprägte und vor allem als Vizepräsident (2001-2009) zahlreiche fatale Entscheidungen verantwortete.
„Misstraue dem stillen Mann. Denn da, wo andere sprechen, beobachtet er. Wo andere handeln, plant er. Und wenn sie sich schließlich ausruhen – schlägt er zu.“ Dieses angebliche Zitat einer anonymen Quelle steht „Vice – Der zweite Mann“ voran und zieht bereits eine Art Bilanz der Hauptfigur des Films: Richard „Dick“ Cheney. Mit zwei Fluchtbewegungen hat Regisseur Adam McKay den republikanischen US-Politiker zuvor in einem zehnminütigen Prolog eingeführt: einmal als ziellosen jungen Mann, der im Jahr 1963 nicht zum ersten Mal nach einer Alkoholfahrt von der Polizei gestoppt wird; das andere Mal als Vizepräsident, der beim Terror des 11. September 2001 in den sicheren Bunker unterm Weißen Haus gebracht wird – ein äußerlich unberührter Fels, der inmitten der schrillen Alarmtöne schon die nächsten Züge plant.
McKay etabliert dies als Eckpunkte im Leben eines Menschen, der sich öffentlich tatsächlich als „stiller“ Mann ohne (auffallende) Eigenschaften gab, während er hinter den Kulissen während der Amtszeit der Präsidenten Richard Nixon, Gerald Ford, George H.W. Bush und George W. Bush an zahllosen maßgeblichen Fäden zog.
Ein „demokratischer Sozialist“
Wie umfassend Einfluss und Macht von Dick Cheney in der US-Politik wirklich waren, ist Gegenstand historischer Spekulationen. Das macht „Vice“ von vornherein klar. Es versteht sich auch, dass der Film ohne Autorisierung von Cheney oder seinem Umkreis entstand. McKay, der sich als „demokratischer Sozialist“ versteht, hielt sich schon in früheren Filmen wie „Anchorman“ oder dem als Abrechnung mit George W. Bush konzipierten Broadway-Special „You’re Welcome America“ nicht mit Kritik am republikanischen Klüngel zurück.
In seinem ersten explizit politischen Spielfilm „The Big Short“ ging McKay dann hart mit den unter der Bush-Regierung ungehinderten Spekulanten ins Gericht, die die Finanzkrise von 2008 ausgelöst haben; der Film war eine satirische Farce, aber zugleich mit der eindeutigen Absicht gedreht, wahnwitzige Wirtschaftsprozesse auch einem ungeschulten Publikum verständlich zu machen.
Wo „The Big Short“ ein Versuch der politischen Aufklärung mit Mitteln des entfesselten Unterhaltungskinos war, ist „Vice“ nun gewissermaßen ein Film der Abklärung. Die Deutung von Dick Cheney als trickreichem und skrupellosem Karrieristen, der sich insbesondere als Vizepräsident eine einzigartige Machtstellung sicherte, ist liberales Gemeingut; auch die Vorwürfe gegen Cheney in Bezug auf den Irakkrieg, den Einsatz von Folter und das Abhören durch Geheimdienste sind nicht neu.
McKays Kunst liegt im Arrangement verfügbaren Text- und Bildmaterials zum argumentativen Unterbau, auf dem sich das eigentliche Thema des Films entfaltet: Der Aufstieg eines Mannes, der mit 22 Jahren im Grunde gescheitert ist, bis ein Machtwort seiner High-School-Freundin Lynne und eigene Einsicht ihm den Weg weisen. So avanciert er Ende der 1960er-Jahre erstaunlich schnell von einer mittelmäßigen Existenz zum willigen „Diener der Mächtigen“, den der Drang nach eigener Macht und die Möglichkeiten der Manipulation vorantreiben – und der sich dabei die Eitelkeit versagt, öffentlich mit dem Erreichten zu prahlen.
Zeitsprünge, Bildmontagen, surreale Momente
McKay geht bei seinem rund fünfzig Jahre umfassenden Film chronologisch vor, wobei Cheneys Lehrjahre unter Nixon sowie die Vizepräsidentschaft von 2001 bis 2009 die ausführlichsten Kapitel umfassen. Wie bei „The Big Short“ setzt der Regisseur auf Bildmontagen, Zeitsprünge und insbesondere auf surreale Momente und Illusionsbrüche, die den Film zu einem ganz und gar unkonventionellen Porträt machen.
Im Unterschied zu „The Big Short“ sind der Stakkato-Schnitt und der Einsatz von Verfremdungstechniken im Stil von Brecht oder Godard jedoch zurückgenommen. McKay will das angestrebte Persönlichkeitsprofil nicht unter technischer Virtuosität vergraben, wobei ihm die einmal mehr erstaunliche Verwandlungskunst von Christian Bale wunderbar zu Diensten ist: Mit Hilfe sorgfältiger Maskenarbeit und Bales bekannter Bereitschaft zum flexiblen Körpergewicht im Dienst der Rolle, vor allem aber mit der Präzision, mit der der Schauspieler Cheney einen unerwarteten Nuancenreichtum verleiht, vom noch naiven Washington-Einsteiger bis zum abgebrühten Meister politischer Winkelzüge, dem das Sprechen aus spöttisch verzogenem Mundwinkel zur zweiten Natur geworden ist.
So unmissverständlich der Film Dick Cheney als politischen Verbrecher zeichnet, fällt der Blick von McKay und Bale weit differenzierter als bei anderen Spielfilmen zur jüngeren US-Politik. Wo sich Oliver Stone bei „W.“ von seiner Verachtung für George W. Bush derart mitreißen ließ, dass er diesen zum gesichtslosen Wicht degradierte und dem Film damit jede erzählerische Kraft raubte, nimmt „Vice“ seine Hauptfigur ernst und lässt deren Vorgehen immerhin folgerichtig erscheinen.
McKay kontrastiert die Politikersphäre mit Cheneys Verhalten in seiner Familie, wobei ganz andere Züge zum Vorschein kommen: sei es im Umgang mit seiner Frau Lynne, die Amy Adams subtil als gespaltene Figur zwischen zielbewusster Unterstützung ihres Mannes und eigenen Ambitionen interpretiert, sei es als liebevoller Vater mit überraschenden Wertgrundsätzen. Cheney sammelt sogar Sympathiepunkte, wenn er den gewalttätigen Schwiegervater entschlossen aus der Familie verbannt, oder seine Tochter Mary nach ihrem lesbischen Coming Out uneingeschränkte Unterstützung von ihm erfährt.
Star im Haifischbecken
Vor diesem Hintergrund tritt die Brutalität von Cheneys Politik umso schärfer hervor, die selbst seine Parteifreunde und engsten Mitarbeiter wie Marionetten betrachtet, denen er im Notfall ohne zu zögern die Fäden zerschneidet. McKay bildet diese Haifischpolitik in vielen Facetten ab, sodass neben Cheney auch andere Protagonisten auf dem Spielfeld der US-Politik der letzten 50 Jahre Profil gewinnen, etwa der von Steve Carell als schmetternder „Falke“ gespielte Donald Rumsfeld und der von Sam Rockwell grandios als übertölpelter Provinzler dargestellte George W. Bush.
Diese Durchleuchtung eines korrupten politischen Systems, die in ihrer Vielschichtigkeit an Paolo Sorrentinos „Il Divo“ erinnert, entgleitet McKay nur dann, wenn er zu Cheneys Anteil am „Krieg gegen den Terror“ und der Invasion des Iraks kommt. Hier verfällt der Film kurzfristig in pure Polemik über die mit Füßen getretenen Menschenrechte, was Aufklärungsansatz wie Unterhaltsamkeit des Films konterkariert.
Doch das sind nur kleine Ausfälle einer bemerkenswert dichten Auseinandersetzung mit dem Wesen von Politik, in der ein Mann wie Dick Cheney nicht zuletzt auch als Symptom einer fatalen Wahltendenz erscheint. Während Serien der letzten Jahre wie „Veep“ oder „House of Cards“ den Eindruck erweckten, als würden weltfremde bis bösartige Politiker und das anonyme Volk in zwei verschiedenen Welten leben, wagt es Adam McKay, die Zuschauer in die Verantwortung zu nehmen. „Vice“ ist nicht zuletzt eine Warnung vor geistiger Trägheit, in der simple Feindbilder und Handstreich-Lösungen erstrebenswert erscheinen, was populistischen Scharfmachern erst zur Macht verhilft. Angesichts des aktuellen politischen Klimas eine Botschaft von universaler Reichweite.
Marius Nobach, FILMDIENST