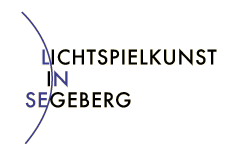
Programm per Email
Werden Sie Mitglied
Werden Sie Mitglied!
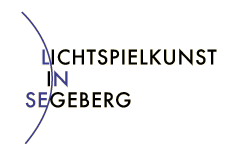

Drama
Regie: Florian Henckel von Donnersmarck
mit: Tom Schilling (Kurt Barnert) · Sebastian Koch (Prof. Carl Seeband) · Paula Beer (Elisabeth Seeband) · Ina Weisse (Martha Seeband) · Saskia Rosendahl (Elisabeth May)
Deutschland 2018 | 189 Minuten | ab 12
Ein junger Maler flieht kurz vor dem Mauerbau aus der DDR in die Bundesrepublik und verliebt sich in eine Studentin, deren Vater jedoch seine Kindheitstraumata aus der NS-Zeit befeuert, da dieser als Euthanasie-Arzt für den Tod der geliebten Tante verantwortlich war. Das mit gewaltigem Aufwand und viel deutscher Schauspiel-Prominenz in Szene gesetzte Künstlerdrama frei nach der Biografie von Gerhard Richter schlägt einen großen historischen Bogen durch drei Jahrzehnte deutscher (Unheils-)Geschichte.
Der größte Star des dritten Films von Florian Henckel von Donnersmarck ist nicht etwa der von innen verlässlich glühende Tom Schilling oder der eiskalt agierende Sebastian Koch. Nein, es sind die nackten Pobacken von Paula Beer. Wie einst bei der Bardot in Jean-Luc Godards „Die Verachtung“ (fd 13 279) schwenkt die Kamera über die wohlgeformten Hügel, erst nach rechts, dann nach links und wieder zurück. Da die Erotik-Einlage auch ohne dramaturgische Funktion gleich mehrfach abgerufen wird, zur Abwechslung erweitert um die Brustpartie, fragt man sich irgendwann, ob die Körperbeschau vielleicht als Atempause gedacht ist, angesichts all der Abgründe der jüngsten deutschen Geschichte, um die es in dem Künstlerdrama eigentlich geht.
Wäre da nicht die verdächtig einseitige Gestaltung von Beers Figur. Deren Innenleben spielt keine Rolle, eine politische Meinung hat sie nicht, dafür aber einiges durchzustehen: Schwangerschaften und Abtreibungen, einen autoritären Vater, der über sie und ihren Unterleib verfügt, und in den Jugendjahren ein DDR-Regime, das ihr seine biedere, von der Ideologie bestimmte Ästhetik aufzwingt. Dass ihre Karriere als Modedesignerin am Rande dahinplätschert, erscheint da nur konsequent. Schließlich hat das ebenfalls auf das Konto von Donnersmarcks gehende Drehbuch für die lieblich lächelnde Kindsfrau eine andere Aufgabe vorgesehen: Immer, wenn Tom Schilling, dem es bestimmt ist, ein großer Künstler zu werden, durch eine Krise geht, hält sie ihm, der zum Sex immer bereit ist, „den Rücken frei“. Geht es für ihn endlich aufwärts, fungiert sie als Bettlaken-Belohnung. Das Frauenbild, das von Donnersmarck anno 2018 postuliert, ist mehr als ernüchternd. Wer daran zweifelt, muss nur dem Soundtrack zuhören: Die französische Kindsfrau Françoise Hardy läuft gefühlt in Endlosschleife.
Leider ist das nicht das einzige Ärgernis eines sich in eigenen Ambitionen verheddernden Wurfs. Nicht, dass der an das Leben des Malers Gerhard Richter angelehnte Stoff kein enormes Potenzial gehabt hätte. Zumal von Donnersmarck nur die Hälfte der an unglaublichen Zufällen, Kollisionen und kollektiven Traumata reichen Richter-Biografie aufgreift. Das immerhin hat Henckel von Donnersmarck, der mit „Das Leben der Anderen“ (fd 37 524) als einer der Ersten die Stasi-Untaten zum Kino-Melodram erhob, erkannt. Was er aber aus dem durch drei Staatsformen bestimmten Werdegang des Malers macht, ist ein mutloser, peinlich braver Ableger all jener auf Publikumszuspruch schielenden Geschichtslektionen à la „Dresden“ (2005), „Unsere Mütter, unsere Väter“ (fd 41 660) oder „Ku’damm 56“ (2016).
Dazu passt der gewaltige Produktionsaufwand, den „Werk ohne Autor“ betreibt: Straßenszenen, Kostümorgien, überbordendes Setdesign. Gleich am Anfang schreitet man durch die Rekonstruktion der Propagandaausstellung „Entartete Kunst“, durch die ein vom Nazi-Jargon besoffener Lars Eidinger 1937 führt. Der kleine, malbegabte Kurt Barnert bekommt hier dank seiner elfenhaft unkonventionellen Tante die Gelegenheit, an der Moderne zu schnuppern. Sie fährt mit ihm im Bus regelmäßig vom ländlichen Umland nach Dresden, das später in einer schlechten Computeranimation im Bombenhagel niederbrennt. Auf dem Rückweg bittet sie die Busfahrer an der Endhaltestelle um ein kollektives Hup-Konzert. Wer diese Schlaghammer-Botschaft nicht versteht, dem ist nicht zu helfen: Diese Frau passt nicht in die herrschende kleinkarierte Grobheit, sie bezahlt für ihre Andersartigkeit einen hohen Preis und gibt vor ihrer Deportation als vermeintlich schizophren Erkrankte dem Jungen einen Rat mit auf den Weg: Schau niemals weg!
Zu einem das Unrecht der Welt bekämpfenden Politkünstler ist Gerhard Richter zwar nicht gerade geworden; zuletzt hat er sich sogar gegen die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel ausgesprochen. Doch die an Hollywood geschulte Dramaturgie erfordert ebenso eine klare Schwarz-Weiß-Zeichnung wie ein ordentliches, nuancenfreies Auserzählen der Ereignisse. Man sieht die Tante in einer Gaskammer mit geistig Behinderten sterben, was sich noch nicht mal als visueller Tabubruch vermittelt.
Verantwortlich für ihr Schicksal ist ein vom Rassenwahn und der Unwertes-Leben-Doktrin besessener Frauenheilkundler, den Sebastian Koch mit beeindruckender Borniertheit spielt. Ihm begegnet der nun erwachsene Kurt, als er an der Dresdner Kunsthochschule die Mode-Studentin Ellie trifft. Die Beziehung seiner Tochter zu dem mittellosen Maler von sozialistisch-realistischen Wandfresken kann der einstige SS-Mann nicht gutheißen. Dank der Protektion eines sowjetischen Militärfunktionärs ist er zwar auf seinen Lehrstuhl zurückgekehrt, muss aber weiterhin die Aufdeckung seiner NS-Identität fürchten. Als seine Legende aufzufliegen droht, setzt er sich in den Westen ab, nicht ohne vorher seine Tochter mit einer Lüge zu einer Abtreibung zu bewegen, in deren Folge diese unfruchtbar wird.
Die einer antiquierten Soap Opera würdige, heillos vorhersehbare Handlung gewinnt in der Bundesrepublik noch an Fahrt, als auch Kurt und Ellie kurz vor dem Mauerbau das Weite suchen. Das sozialistische Paradies bekommt für den jungen Maler dadurch gewaltige Risse, auch wenn man von dem Alltag der Menschen nichts mitbekommt. Dafür sind die DDR-Professoren eigentlich grundgütige Menschen, und die Stasi droht nur durch ihre schattenhafte Anwesenheit. Kurts Vater, der aus Opportunismus in die NSDAP eingetreten war, trifft es allerdings hart. Er darf nicht mehr als Lehrer arbeiten, sondern muss sich mit Treppenputzen durchschlagen und begeht Selbstmord – eine von vielen zweifelhaften Verdichtungen des Drehbuchs. Der Vater von Gerhard Richter kam in einem Büro unter.
An der Düsseldorfer Kunstakademie, wo es den nach Freiheit durstenden Kurt hinverschlägt, bekommt das zunehmend kulissenhafte Historiendrama im schlechten Sinne Flügel; man wähnt sich kurzzeitig in einer Teenie-Komödie. Die Künstler glänzen durch dick aufgetragene Exzentrizität, die Wiedergänger von Sigmar Polke und Günther Uecker albern durch die Treppengänge wie in einem Musical, während eine Beuys-Karikatur Wahlplakate in Brand setzt, von Revolution palavert und ihre Filz-und-Fett-Tataren-Mythen zum Besten gibt, als wären diese aktenkundig belegt. Die Ambivalenzen der jüngsten Debatten um den Kunst-Erlöser Joseph Beuys sind hier anscheinend noch nicht angekommen.
In dieser Umgebung, die unentwegt über das eigene Kunstverständnis auf plattestem Level reflektiert, findet Kurt nach zähem Ringen seinen Stil, der keiner Autorschaft mehr bedarf. Er malt Fotografien hyperrealistisch ab und collagiert sie zu anklagenden zeitgeschichtlichen Dokumenten, auf denen seine der Euthanasie zum Opfer gefallene Tante auf ihre Mörder, allen voran Kurts Schwiegervater, trifft. Zu allem Überfluss taucht der wieder zu Ehren gekommene Mediziner regelmäßig in dem Atelier auf, um seine Verachtung über Kurts „Sinnleere“ loszuwerden. Der vorprogrammierte Showdown aber, bei dem der Täter im Anblick der Kunst mit seinen Verbrechen konfrontiert wird, beleidigt die Intelligenz aller, die eigene Schlüsse ziehen können und nicht jede Wendung bis zum Äußersten vorgekaut bekommen möchten. Es will schon etwas heißen, dass selbst die Musik von Max Richter an dieser Stelle nicht funktioniert und zu einer pathetisch-nervösen Gewitterwolke verkommt.
Spätestens jetzt hätte die Schlussklappe kommen müssen. Stattdessen folgt im Finale die erste große Ausstellung des sich ins Establishment irritierenden Kurt. Er ist nun auf dem Weg zum teuersten Maler seiner Zeit, zum genialen Heroen, der sich gegen alle Widerstände durchsetzt, während Ellie der Pressekonferenz mal wieder unscheinbar lächelnd beiwohnt und dabei den unverhofften Nachwuchs (offensichtlich doch nicht unfruchtbar!) hütet.
Alexandra Wach, FILMDIENST